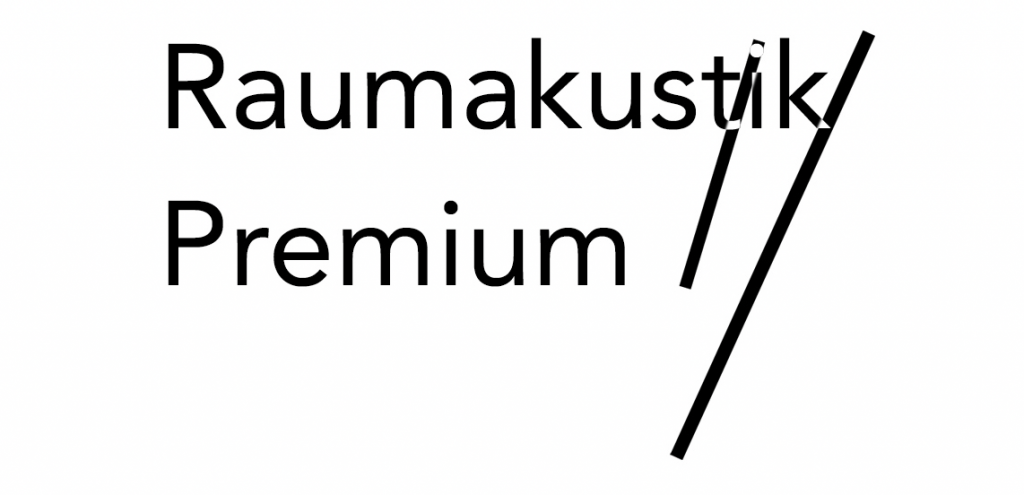Lärmbekämpfung in Räumen muss sich primär auf die Raumkanten stützen – nicht auf die Begrenzungsflächen eines Raumes. Wegen des besonderen Störpotenzials des Kantenvolumens sind es diese, die Raumkanten und -ecken, auf die man zu allererst schauen muss.
… statt Absorption auf Teufel-komm‘-raus
Was in der Raumakustik als „Stand der Technik“ gilt, wäre böswillig, wenn es nicht schlicht ein Irrtum wäre:
Es ist sachlich nicht richtig, dass ein kurzer Nachhall für einen klaren Raumklang und eine so genannt „gute Hörsamkeit“ sorge. Nicht einmal der Lärmbekämpfung dienen starke Bedämpfungen, obwohl die Räume dann im ersten Hören stets ruhig erscheinen. Sondern der Nachhall ist ein subjektiv sehr unterschiedlich empfundenes Kriterium für so etwas wie akustischen Komfort.
Es ist weiterhin sachlich nicht richtig, dass es mehr oder weniger egal sei, wo absorbierende Oberflächen installiert werden. Sondern erstens ist es sehr wohl wichtig, WO man überschüssige Schallenergie einfängt. Und zweitens ist physikalisch nicht richtig, dieses allein durch poröse Absorber leisten zu können.
In der Lärmbekämpfung aber tut man genau das viel und gern: Absorbieren was das Zeug hält – fast ausnahmslos mittels poröser Materialien.
ReFlx®: Lärmbekämpfung ohne Nebenwirkungen
Wenn ich mit der folgenden Abbildung nun aber selbst poröses Material zeige, dann mag Irritation aufkommen. Der Unterschied jedoch ist, dass dieses absorbierende Material die überschüssige Schallenergie im begrenzten Kantenvolumen absorbiert. Der Frontreflektor definiert Umfang & Charakter der Wirksamkeit innerhalb des Frequenzbandes. Jedoch, was an Schallenergie hinter den Frontreflektor gelangt ist, kehrt ohnehin nicht mehr zurück in den Raum.
Im Bildbeispiel wird durch den Einsatz von porösem Material die Wirksamkeit zugunsten der Inklusion sehr wohl verstärkt. Hingegen wird das Frequenzspektrum nicht beeinträchtigt.

Auch ist die Behauptung nicht richtig, die Senkung des Nachhalls sorge zwangsläufig für Klangqualität und Komfortgefühl. Sondern in Umgebungen mit geringen Nachhallzeiten sind regelmäßig die mittleren und höheren Frequenzen besonders stark beeinträchtigt. Deshalb klingen solche Räume umso muffiger, dumpfer, beengter, je stärker sie bedämpft sind.
Starke Bedämpfungen führen somit oft dazu, dass Räume als erdrückend oder deprimierend wahrgenommen werden. Das hat auch damit zu tun, dass die Sprachkommunikation in stark bedämpften Räumen sehr anstrengend ist. Man ist gezwungen, lauter zu sprechen – und man muss umso mehr die Ohren spitzen.
Außerdem wird dem Gehrin durch starke Bedämpfungen auch die Möglichkeit genommen, sich über den Gehörsinn Informationen über seine Umgebung einzuholen. Die unterbewusste Orientierung ist damit stark eingeschränkt. Die Reaktionen darauf sind individuell sehr unterschiedlich. Überwiegend aber ist das Gehirn dadurch subtil mit einer Bedrohungssituation konfrontiert.
Hörsinn ist 24/7 aktiv
Ohnehin ist bereits seit Jahrzehnten weithin bekannt, was die meisten in der Akustikbranche Tätigen auch gern mit Amüsement und offen einräumen:
„Ist die Nachhallzeit kurz, dann ist die Sprachverständlichkeit noch lange nicht gut. … ist der Raumklang nicht zwangsläufig klar und rein.“
Auch die kritischen Betrachtungen, die Wallace C. Sabine schon vor über 100 Jahren gegenüber der Absorption beigetragen hat, könnten für die Wissenschaft ein Ansporn sein. Stattdessen begnügt man sich damit, dass Sabine recht früh eine Formel entwickelt hatte, mit der sich leicht arbeiten lässt.
Maßgeblich für die Klarheit oder Reinheit von Klang ist das Ausmaß der Bewältigung von Störeinflüssen, die explizit im Kantenvolumen entstehen. UND zugleich ist der Ausgleich, die Harmonisierung der tatsächlichen Schallenergie im Raum von bedeutender Wichtigkeit. Es geht dabei um nicht weniger als die bloße Energie.
Schall erliegt in Abhängigkeit von den Frequenzen in unterschiedlichem Maße sowohl allein schon der Luftdämpfung, als auch der Absorption durch unterschiedliche Materialien und Körper (im weitesten Sinne: von anwesenden Personen bis zu Gegenständen aller Art oder auch baulichen Gegebenheiten). Dabei allerdings ist, von „Wellenlängen“ auszugehen, ein Irrweg und eine fehlerhafte Modellvorstellung.
Bedämpfung: nicht automatisch Lärmbekämpfung
Die Installation des ReFlx®-Systems sorgt dafür, dass ruhig und entspannt gesprochen werden kann.
Die oberen Mittenfrequenzen und die hohen Frequenzen – die allein durch die Luftdämpfung ab ca. 4 Metern Entfernung zu originär Sprechenden oder zu einer Lautsprecherquelle bereits zu stark abgeschwächt sind – erfahren mittels ReFlx® eine so deutliche Verstärkung, dass in durchschnittlich großen Klassenräumen oder Besprechungsräumen das Verstehen von Sprache an JEDEM Hörort im Raum gleich gut gelingt.
Umgekehrt kann man an jedem beliebigen Ort in einem solchen Klassenraum oder Besprechungsraum einen Einwurf oder Beitrag leisten: Jeder an jedem anderen Hörort im Raum kann ihn einwandfrei verstehen.
gute Hörsamkeit = entspannte Atmosphäre
Das – nun auf eine Schulklasse bezogen – führt dazu, dass Lehrkräfte eine deutliche Entlastung verspüren… und entspannt unterrichten. Die Nerven von Lehrkräften zu schonen UND zugleich Schülerinnen und Schülern das Verstehen und die Teilnahme am sprachlichen Austausch zu erleichtern, führt „wie von selbst“ zu einer effektiveren Unterrichtung. – Und zu ECHTER Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche.
Oder auf Unternehmen oder Verwaltungen bezogen, führt eine gute Raumakustik zu einer entspannten Atmosphäre bei Besprechungen, Verhandlungen, Seminaren…