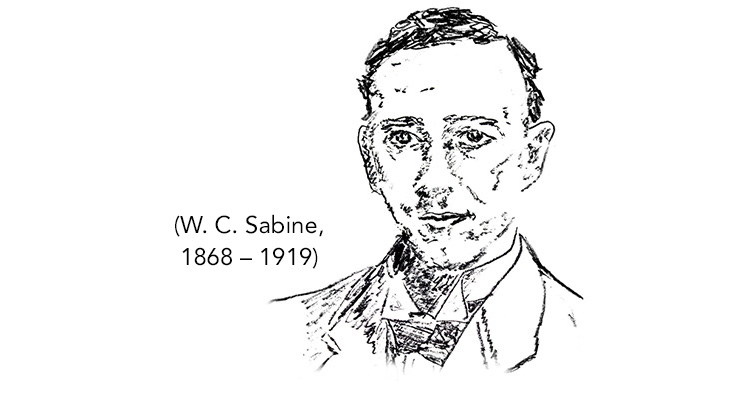Das eigentliche, das Kernproblem für die Raumakustik in kleinen bis mittelgroßen Räumen liegt in den Raumkanten verborgen.
Für Mehrpersonenbüros oder für Räume, die dem geselligen Beisammensein oder der Ruhe und Entspannung dienen sollen, bedeutet dies, dass man mit der Absorption der Schallenergie in den Raumkanten beginnen sollte. Für Kommunikationsräume hingegen reicht es nicht, über reine Kantenabsorber nur zu entstören. Sondern in Versammlungsräumen, in Besprechungs- und Seminarräumen oder in Klassenräumen bedarf es einer Ausstattung, die die sprachlichen Nutzsignale verstärkt: Es gilt, ein harmonisches Klangfeld im gesamten Raum zu erzeugen. Und das im besten Falle passiv, also ohne elektroakustische Anlagen – weil man dann nicht angewiesen ist auf zusätzliche Investitionen und auf regelmäßige Wartungen und Aktualisierungen.
Das ReFlx®-System schlägt sozusagen „zwei Fliegen mit einer Klappe“. Heute nennt man das auch ‚two in one‘. Es wirkt als Kantenabsorber – und zugleich als Verstärker vor allem der höheren Frequenzen. ReFlx® erzielt in kleinen bis mittelgroßen Räumen (etwa Klassenräume oder durchschnittlich große Besprechungs- oder Seminarräume) eine außerordentliche Klarheit des Klanges und eine herausragende Sprachverständlichkeit.
Problemzone ‚Raumkanten‘
Es ist ein Irrtum, dass ein geringer Nachhall erforderlich sei, um eine gute Sprachverständlichkeit zu erzielen. Auch wenn in DIN 18041 gebetsmühlenartig immer wieder darauf hingewiesen wird. „Gute Hörsamkeit“ kann nicht gleichgesetzt werden mit kurzen Nachhallzeiten.
Sondern erstens und zuerst muss das störende Potenzial der Raumkanten ausgeschaltet werden. Dazu bedarf es nicht – wie bisher stets angenommen – der Absorption oder der Resonanz. Sondern das Energiepotenzial in den Raumkanten kann mit schallharten Reflektoren bezwungen werden.
Zweitens macht man sich idealerweise wiederum das Kantenvolumen zunutze, um das Missverhältnis zwischen den unterschiedlichen Frequenzen angemessen auszugleichen. Denn zwangsläufig erschaffen Räume ein unausgewogenes Frequenzband. Und poröse Absorber verstärken dieses noch, mit dem Schwerpunkt der absorbierenden Wirkung in den höheren Frequenzen..
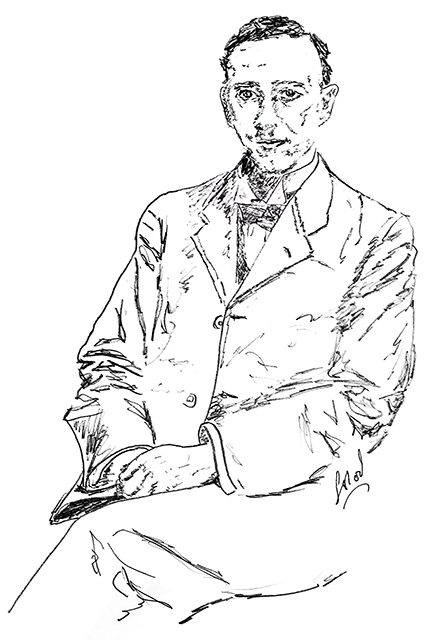
Man muss sich einmal vor Augen führen, dass Wallace C. Sabine – als echter Pionier in der Raumakustik – letztlich seine Arbeiten nicht hatte zu Ende bringen können. Dabei ist unerheblich, ob Sabine an seiner Nierenentzündung starb oder an den Folgen der Behandlung. Jedenfalls verstarb er im Alter von nur 50 Jahren nicht nur im Sinne der Forschung erheblich verfrüht.
Frequenzen unausgewogen
Auf dieses Missverhältnis – das Wallace C. Sabine umso mehr auffiel, je mehr Absorption er in einen Raum eintrug oder auch, je mehr Publikum in einem Saal zugegen war – hatte der amerikanische Physiker bereits vor über 100 Jahren hingewiesen und es verständlich beschrieben!
Dazu im völligen Widerspruch beschränkt man sich darauf, die lückenhafte und extrem vereinfachende sog. „Sabine’sche Formel“ anzuwenden. Und stützt damit die Forderung nach Absorption.
Nur ein kurzes Beispiel aus Sabine’s Fachbeiträgen: „In den tiefen Tönen kommt der Einfluss des Publikums deutlicher zum Ausdruck. Zum Beispiel, wieder ein C1 64 gewählt, verringert der Einfluss des Publikums den ersten Oberton um rund 60 % in Relation zum Grundton, den zweiten Oberton um mehr als 75 %.“ (W. C. Sabine, Collected Papers on Acoustics; Forgotten Books – Seite 82)
•• erläuternder Einschub: „C1 64“ ist nach heutiger Einteilung C2 – allerdings in anderer Lesart bei 65,4 Hz. Denn W. C. Sabine ging vom Grundton A der natürlichen Tonleiter bei 432 Hz aus, während heute international der Grundton A mit 440 Hz definiert ist. So aber hat bei Sabine der heutig auch als „tiefes C“ bezeichnete Ton 64 Hz. ••
Solche und weitere Ausführungen Sabine’s können leicht auf den Zusammenhang zwischen Absorption und Sprachverständlichkeit übertragen werden. Die Konsequenzen decken sich in plausibler Übereinstimmung mit der Praxis in Kommunikationsräumen.
Wallace C. Sabine beweist Problembewusstsein
Zwar hatte W. C. Sabine in seiner ersten Publikation im Jahre 1900 im ‚American Architect‘ seine mathematischen Betrachtungen verhängnisvoll in die Welt gesetzt. Doch bereits 1906 hatte er begonnen, in weiteren Publikationen sehr klar darauf hinzuweisen, dass mit zunehmender Absorption die Obertöne immer stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. Mehrfach hat Sabine auf dieses wachsende Missverhältnis der Frequenzen untereinander hingewiesen. Vereinfacht könnte man von ‚Dumpfheit‘ und Ausdruckslosigkeit sprechen, wenn umso mehr Details verloren gehen, je höher eine Frequenz ist und eine je stärkere Absorption den Raum beherrscht.
Dabei muss man sich aber auch bewusst machen, dass allein schon eine zunehmende Anzahl an Personen (Kinder oder Jugendliche in Klassenräumen; Teilnehmende an Besprechungen oder Seminaren; Publikum in Sälen oder Hallen) den Nachhall zwar bedeutsam bis stark senken, aber dabei das störende Potenzial der Raumkanten höchstens minimal, nämlich in der praktischen Relevanz überhaupt nicht berühren! Und zwar deshalb, weil Personen in einem Raum allein in einem begrenzten Raumvolumen, nämlich eher nahe der Bodenebene den Schall absorbieren, d. h. den Nachhall vor allem in mittleren und höheren Frequenzen durch die allgemeine Absorption reduzieren.
Raumkanten als Lärmtrichter
Insbesondere in die oberen Raumkanten hinein jedoch gelangt der Schall ungemindert. Dort baut sich ein hoher Schalldruck auf, während zugleich aus den Raumkanten heraus kein geordneter Rückwurf stattfindet. Je nach Besetzungsdichte eines Raumes kann Publikum das Störpotenzial der unteren, den Boden berührenden Raumkanten schwächen oder ausschalten – niemals aber Einfluss auf die oberen Raumkanten auch nur abschwächen.
Sabine – zu früh verstorben – hatte 1915 in einer Publikation darauf hingewiesen, dass die Analyse der einzelnen Reflexionen in einem Raum nicht gelinge: „Dieses Phänomen nennt man Widerhall, einschließlich des Echos als Spezialfall. Man muss jedoch beachten, dass ganz allgemein der Widerhall resultiert aus einer Vielzahl von Schallereignissen, die den ganzen Raum erfüllen – die sich der genauen Analyse der verschiedenen Reflexionen entziehen. Es ist schwer, sie im Einzelnen wiederzuerkennen und unmöglich, sie genau zu lokalisieren.“ (Sabine, W. C.: Collected Papers on Acoustics; Forgotten Books – Seite 220)
Und so war es Sabine nicht mehr gelungen, explizit die Raumkanten (bzw. das Kantenvolumen, also einschl. der Raumecken) als eigenständige, akustische Störungen erzeugende Raumvolumina zu entlarven und entsprechend gesondert zu berücksichtigen. Auch hatte Sabine den Widerhall im Sinne des Gesamtschallereignisses in einem Raum etabliert als EINE Kenngröße.